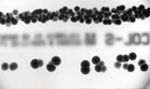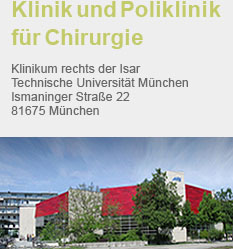
Endokrine Pankreastumore
Endokrine Tumore
Endokrine Drüsen stellen Produktionsstätten für Botenstoffe - sogenannte Hormone - dar, die bei der Regulierung von unterschiedlichen Körperfunktionen maßgeblich mitwirken. Hormone vermitteln bestimmte Informationen an die Zelle; so führt beispielsweise Insulin zum Übertritt von Glukose aus dem Blut in die Zelle oder das Schilddrüsenhormon beeinflusst die Aktivität des Körpers. Ein komplizierter Regelmechanismus führt dazu, dass bei einem gesunden Menschen immer die richtige Hormonmenge - oft auch angepasst an die Lebensgewohnheiten - gebildet und ins Blut abgegeben wird. Wenn nun hormonbildende Zellen entarten, so kann entweder zu viel oder zu wenig dieses Botenstoffes gebildet werden. Auch der Regelmechanismus wird gestört.
Durch unterschiedliche äußere Einflüsse oder Veränderungen der Erbmasse können sich hormonbildende Zellen bösartig verändern oder aber am Ort wuchern, ohne alle Kriterien der Bösartigkeit (Malignität) zu zeigen. Endokrine Tumore sind zumeist gut differenzierte Tumore, welche nur langsam wachsen und daher als gutartig einzustufen sind. Allerdings gibt es auch endokrine Tumor, welche sich wie bösartige Tumore verhalten und in umliegende Organe einwachsen und Absiedlungen in entfernten Organen bilden.
Etwa 50% der endokrinen Tumore des Pankreas gehen zwar von hormonproduzierenden Zellen aus, bilden aber selbst keine Hormone mehr, sind also Hormon-inaktiv. Demgegenüber stehen die hormon-bildenden Tumore. Da beide aus denselben Zellen hervorgehen, produzieren beide Tumoren „Marker“, die auf Ihre gemeinsame Abstammung hinweisen. Da diese Marker auch in Nervenzellen vorkommen werden die endokrinen Pankreastumore auch neuroendokrine Tumore genannt.
Bei manchen Patienten mit einem vererblichen Gendefekt kommen neuroendokrine Pankreastumore in Kombination mit endokrinen Tumoren in anderen Organen wie z.B. der Nebenschilddrüse oder der Nebenniere vor (sog. multiple endokrine Neoplasie). Da diese Erkrankung vererblich ist, sind häufig mehrere Generationen betroffen. In diesen Fällen kann eine genetische Untersuchung Aufschluß über die Grunderkrankung bringen. Betroffene Familienmitglieder müssen engmaschig kontrolliert werden, um entstehende Tumore frühzeitig zu erkennen.
Anders als die Hormon-inaktiven neuroendokrinen Tumore, können die hormon-produzierenden Tumore je nach sezerniertem Botenstoff weiter eingeteilt werden:
A. Insulinom
Das Insulinom ist der häufigste hormonproduzierende Tumor der Bauchspeicheldrüse. Er bildet unreguliert Insulin, das dann seine Wirkung ausübt, ohne dass ein hemmender Regelkreis die Insulinbildung stoppt. Das führt zu den charakteristischen Zeichen von Unterzuckerung, die jeder insulinspritzende Diabetiker kennt. Häufige Symptome sind: Schwitzen und Zittern, Herzklopfen, Schwäche, Angst, Sehstörungen, Aggressivität, im schlimmsten Fall auch Bewusstseinsverlust. Weil der Patient merkt, dass es ihm durch Essen besser geht, nehmen die Patienten häufig Gewicht zu. Der Arzt findet bei der Abklärung die Zeichen einer unnatürlichen Unterzuckerung in einem Fastentest. Die Lokalisation dieses Tumors, der oft sehr klein ist oder auch in Mehrzahl vorkommen kann, ist oft schwierig. Die Therapie der Wahl ist die chirurgische Entfernung des Tumors aus der Bauchspeicheldrüse. Lassen sich Metastasen nachweisen und sind diese nicht zu entfernen, ist eine ergänzende Chemotherapie möglich.
B. Gastrinom
Einen weiteren, nicht seltenen, hormonproduzierenden Tumor stellt das Gastrinom dar. Der Tumor befindet sich in der Bauchspeicheldrüse; er kann aber auch in anderen Organen lokalisiert sein, z.B. im Magen oder dem Zwölffingerdarm. Er ist oft bösartig und metastasiert früh. Die Patienten leiden an medikamentös kaum beherrschbaren Magen-Darm-Geschwüren, die durch die vermehrte Produktion des im Tumor gebildeten Hormons Gastrin entstehen. Gastrin regt die Magensäurebildung an.
Therapeutisch gilt es, den Tumor zu entfernen. Bei Metastasierung des Gastrinoms wird versucht, mit säurehemmenden Medikamenten die Symptome zu lindern. Früher wurde der ganze Magen entfernt, so dass keine Geschwüre (Ulcera) mehr entstehen konnten, weil keine Säure mehr gebildet wurde. Heute gibt es jedoch Medikamente, welche die Säurebildung effizient blockieren.
C. VIPom und Glukagonom
Das VIPom und Glukagonom sind weitere seltene Tumore. Beide finden sich häufig im Bereich der Bauchspeicheldrüse. Das Glukagonom manifestiert sich ähnlich wie die Blutzuckerkrankheit Diabetes mellitus, weil Glukagon zu einer Erhöhung des Blutzuckers führt. Außerdem haben diese Patienten häufig noch Veränderungen an der Haut. Das Verner-Morrison-Syndrom entsteht, wenn in einem endokrinen Tumor VIP (vasoaktives intestinales Polypeptid) gebildet wird. Dieses Hormon regt die Sekretion des Dünndarmes und des Pankreas an und führt unkontrolliert produziert zu wässrigen Durchfällen, Kalium-Salz Mangel und einem Chloriddefizit im Sekret des Magen-Darm-Traktes. Es entsteht eine ausgeprägte Übersäuerung des Körpers. In allen Fällen ist die Identifikation und Lokalisation des Tumors schwierig. Auch kleine Tumore bilden sehr frühzeitig Metastasen, so dass eine begleitende Chemotherapie neben der symptomatischen Behandlung nötig wird.
D. Andere endokrine Tumore
Wie oben beschrieben gibt es endokrine Tumore, die keine messbaren Hormone produzieren. Deren Diagnostik ist ebenfalls oft schwierig. Andererseits ist ihr Wachstumsverhalten und der Metastasierungstyp anders als das häufige, exokrine Pankreaskarzinom, so dass ein anderes chirurgisches Vorgehen und ggf. eine andere Strahlen- und Chemotherapie notwendig sind.
Zystische Pankreastumore
Neben dem häufigen duktalen Adenokarzinom und endokrinen Pankreastumoren gibt es die sog. zystischen Pankreastumore, welche Hohlräume (sog. Zysten) enthalten. Diese Tumore sind relativ selten und stellen wahrscheinlich nur ca. 1% - 5 % aller Pankreastumore dar. Diese Tumore lassen sich aufgrund geweblicher und molekularer Unterschiede weiter einteilen.
- mucinöse zystische Pankreastumore
- Intraduktale papilläre muzinöse Neoplasie (IPMN)
- Muzinöse zystische Neoplasie (MCN)
- seröse zystische Pankreastumore
- seröses zystische Neoplasie (SCN)
- andere zystische Pankreastumore
- solider-pseudopapillärer Tumor (SPT)
A. Intraduktale papilläre muzinöse Neoplasie (IPMN)
Dieser Tumor zeichnet sich durch schleimbildende (muzinöse) Tumorzellen aus, welche faltenartig (papillär) in den Pankreasgang wachsen. Der von den Tumorzellen produzierte Schleim kann zu einer Verlegung der Pankreasgänge führen, welche sich in der Folge hohlraumartig (d.h. zystisch) erweitern. Typischerweise sind Männer zwischen dem 7. und 8. Lebensjahrzehnt betroffen. IPMNs lassen sich aufgrund charakteristischer Zeichen im Computertomogram meist erkennen. Der durch den Tumor produzierte Schleim kann darüber hinaus während einer ERCP Untersuchung nachgewiesen werden und ist ein fast sicheres Zeichen auf ein IPMN.
IPMNs sind meist gutartig, jedoch können auch Formen mit Zellatypien vorkommen, welche sich im weiteren Verlauf in bösartige Tumor entwickeln können. Da IPMNs darüber hinaus auch noch teilweise multifokal (d.h. an mehrer Stellen gleichzeitig) entstehen, ist die Therapie oft schwierig. Betrifft das IPMN den Pankreashauptgang wird heute eine komplette Entfernung angeraten. Im Nebengang lokalisierte IPMNs können im Einzelfall auch beobachtet werden. Ein Behandlung durch ein interdisziplinäres Team aus Fachleuten, wie sie am Pankreaszentrum des Klinikum rechts Isar vorliegt, wird dementsprechend empfohlen.
B. Muzinöse zystische Neoplasie (MCN)
MCNs entstehen aus schleimbildenden Zellen, die Hohlräume (Zysten) bilden. Anders als IPMNs betreffen MCNs fast ausschließlich Frauen in den Wechseljahren. Diese Tumore kommen zumeist im Schwanz der Bauchspeicheldrüse vor und sind selten multifokal. Sie zeichnen sich durch gewebliche Charakteristika aus, wie sie auch in den Ovarien (Eierstöcken) gefunden werden. MCNs können vollständig gutartig sein (muzinöses Zystadenom), aber auch variable Anteile atypischer, zur Entartung neigender Zellen enthalten. Aus diesen Zellen kann sich im schlimmsten Falle ein invasiver bösartiger Tumor bilden (muzinöses Zystadenocarcinom). Die Therapie der Wahl ist die sichere chirurgische Entfernung der Läsion.
C. seröse zystische Neoplasien
Diese Tumore werden von nicht-schleimbildenden Zellen, die von Teilen des Pankreasgangsystems ausgehen, gebildet. Seröse Zystadenome sind gutartige Tumore, die meist kleinste Hohlräume (sog. Mikrozysten) bilden, welche den Tumor ein schwammähnliches Aussehen geben. Die Tumoren kommen häufiger im Körper und Schwanz der Bauchspeicheldrüse als in deren Kopf vor und sind bei Frauen häufiger als bei Männern. Eine bösartige Umwandlung des Tumors (seröses Zystadenokarzinom) ist extrem selten, so dass bei sicherer Diagnose häufig auf eine Operation verzichtet werden kann.
D. solider-pseudopapillärer Tumor (SPT)
Dieser seltene Tumor, der vorwiegend bei jungen Frauen vorkommt, gibt bis heute Rätsel auf, da immer noch unklar ist, aus welchen Zellen der Bauchspeichldrüse er sich entwickelt. Die im Tumor vorkommenden Hohlräume gehen auf abgestorbene und untergegangene Tumorzellen zurück. Dieser Tumor kann durch eine komplette chirurgische Resektion in den allermeisten Fällen vollständig geheilt werden. Tumorabsiedlungen in anderen Organen sind beim SPT sehr selten.












 erhält Young Investigator Grant 2023 der IAP und der APA Foundation für Forschung
erhält Young Investigator Grant 2023 der IAP und der APA Foundation für Forschung