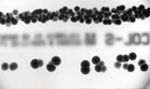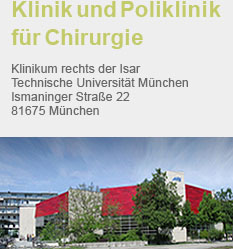
Die Untersuchungen
Welche Untersuchungen erwarten mich?
Der Arzt wird zuerst anhand der Beschwerden, die der Patient ihm schildert, und der körperlichen Untersuchung den Verdacht äußern, dass etwas an der Bauchspeicheldrüse nicht stimmt. Um diesen Verdacht weiter zu erhärten und um die genaue Art der Erkrankung der Bauchspeicheldrüse festzustellen und abzuklären, wird der Arzt, neben einer Blutuntersuchung, meist mehrere Zusatzuntersuchungen durchführen.
Um festzustellen, ob die Bauchspeicheldrüse hinsichtlich der Verdauung und Blutzuckerregulation normal funktioniert, werden meist folgende zwei Untersuchungen durchgeführt.
A. Messung der Stuhlelastase
In einer kleinen Stuhlprobe des Patienten kann mit Hilfe eines sogenannten „Marker“-Enzymes bestimmt werden, ob die Bauchspeichedrüse noch ausreichend Verdauungsenzyme produziert. Es kann dann zwischen einer normalen Funktion sowie leichter und schwerer Einschränkung der Bauchspeicheldrüsenfunktion unterschieden werden. Es gibt jedoch auch andere Untersuchungen, um die Funktion der Bauchspeicheldrüse zu testen.
B. Der orale Glukose Toleranz Test
Bei dieser Untersuchung muss der Patient eine bestimmte Menge zuckerhaltiges Wasser trinken, wobei vorher und nach 1 und 2 Stunden Blutproben zur Blutzuckerbestimmung abgenommen werden. Mit diesem Test kann bestimmt werden, ob eine Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus) oder eine Vorstufe (sogenannter latenter Diabetes mellitus) vorliegt.
Im folgenden Abschnitt werden verschiedene bildgebende Untersuchungsmethoden beschrieben, die dem Arzt zur Diagnose von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen zur Verfügung stehen.
Der Ultraschall (Sonographie)
Der Ultraschall (Abb. 2) ist die einfachste Untersuchung, um ein Bild aus dem Innern des Körpers zu erhalten. Durch einen Sensor (Ultraschallkopf), welchen der Arzt auf den Körper auflegt, werden Schallwellen in das Innere des Körpers gesendet. Diese werden von den verschiedenen Organen wieder zurückgeworfen und vom gleichen Sensor registriert. Dabei werden die Schallwellen an den verschiedenen Organen verschieden stark reflektiert. So entstehen Bilder, aus denen man die verschiedenen Bauchorgane, wie z.B. Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse erkennen kann. Entsprechend den erhaltenen Bildern kann der Arzt krankhafte Veränderungen an diesen Organen erkennen.
Die Ultraschalluntersuchung wird dabei etwa wie folgt ablaufen: Zur Verbesserung der Bildqualität sollte man einige Stunden vor der Untersuchung nichts mehr zu sich nehmen (nüchtern bleiben), da sonst zuviel Luft im Darm vorhanden ist, was die Untersuchungsqualität einschränkt. Die Untersuchung wird auf dem Rücken liegend durchgeführt. Bevor der Schallkopf auf die Haut aufgelegt wird, wird noch ein Gel aufgetragen, damit der Kontakt zwischen Haut und Schallkopf verbessert wird. Bis auf ein mögliches Kältegefühl durch die Auftragung des Gels, sind weder Schmerzen noch andere Unannehmlichkeiten mit dieser Untersuchung verbunden. Der Ultraschall hat keinerlei Nebenwirkungen.
Das Computertomogramm (CT)
Dies ist wahrscheinlich die am häufigsten durchgeführte Untersuchung bei Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen. Das Computertomogramm (Abb. 3) arbeitet mit Röntgenstrahlen. Durch eine Vielzahl von genauen Schnittbildern durch den Körper ist es möglich, einen sehr genauen Eindruck vom Zustand der Bauchspeicheldrüse und der umliegenden Organe zu erhalten.
Die Untersuchung läuft etwa wie folgt ab: Ungefähr eine halbe Stunde vor der Untersuchung muss der Patient eine Flüssigkeit trinken, damit sich der Magen und der Darm später im Bild darstellen lassen und von anderen Organen zu unterscheiden sind. In einem speziellen Untersuchungsraum muss der Patient auf einem automatisch verschiebbaren Röntgentisch liegen. Über einen Lautsprecher erhält der Patient Anweisungen und Informationen vom Kontrollraum. Nun wird der Röntgentisch mit dem Patienten durch eine Röhre gefahren und die Schnittbilder werden angefertigt. Während der zweiten Hälfte der Untersuchung wird ein jodhaltiges Kontrastmittel in die Armvene gespritzt, damit die Gefäße und die Bauchorgane besser dargestellt werden. Die ganze Untersuchung dauert etwa eine halbe Stunde. Sollte bei Ihnen eine Kontrastmittelallergie bekannt sein, sollten Sie dem Röntgenarzt und seinen Mitarbeitern unbedingt vor der Untersuchung darüber informieren.
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT)
Die MRT-Untersuchung ist eine ähnliche Untersuchung wie das Computertomogramm. Auch hier werden Schnittbilder der Körpers angefertigt. Die Untersuchung verwendet jedoch keine Röntgenstrahlen, sondern arbeitet mit Hilfe von sich verändernden Magnetfeldern. Hierfür muss sich der Patient in eine geschlossene Röhre legen und versuchen, möglichst während der ganzen Untersuchung ruhig liegen zu blieben (Abb. 4). Menschen mit Platzangst sollten ihren Arzt vorher auf diese Tatsache aufmerksam machen. Auch Patienten, die einen Herzschrittmacher oder andere künstliche metallhaltige Prothesen besitzen, müssen den Arzt darüber informieren. Da die Magnet-Resonanz-Tomographie mit Magnetismus arbeitet, können im Körper liegende Metalle eventuell Störungen der Untersuchung verursachen. Dauer der Untersuchung: etwa eine bis eineinhalb Stunden. Mit der Magnet-Resonanz Tomographie lassen sich in der Zwischenzeit auf präzise Aufnahmen des Pankreas- und Gallegangssystem anfertigen.
Endoskopische Retrograde Cholangio-Pankreaticographie (ERCP)
Die ERCP dient dazu, einen präzisen Eindruck der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüsengänge zu erhalten. Dies kann eine wichtige Ergänzungsuntersuchung zu den anderen bildgebenden Verfahren sein. Neben der Untersuchung kann mit dieser Technik auch gleich eine Therapie durchgeführt werden. So können zum Beispiel Gallensteine oder Pankreassteine entfernt werden, welche den Gallen- oder Pankreashauptgang verstopfen.
Die Untersuchung wird etwa wie folgt durchgeführt:
Zu dieser Untersuchung wird der Patient meist durch die Gabe eines Medikamentes schläfrig gemacht (sediert), so dass er weniger von der Untersuchung miterlebt. Dies bedingt, dass der Patient 6 Stunden vorher nichts essen oder trinken sollte.
Auch wird ihm eine Infusion am Vorderarm angelegt, worüber er ggf. ein einschläfernden Mittel, ein Antibiotikum und andere Medikamente vor und während der Untersuchung erhält.
In Seitenlage wird dem Patient, wie bei der Magenspiegelung, ein Schlauch (Endoskop) über den Mund eingeführt (Abb. 5). Dieser wird bis in den Zwölffingerdarm vorgeschoben. Über einen Bildschirm sieht der Untersucher, wo er gerade ist. Dort, wo der Gallen- und Pankreasgang in den Zwölffingerdarm münden, wird ein dünner Schlauch (Katheter) aus dem Endoskop ausgefahren und in den Gallengang/Pankreashauptgang eingeführt. Nun wird Kontrastmittel über diesen Schlauch in die Gänge eingespritzt und Röntgenbilder werden angefertigt.
Manchmal ist es nötig, mit einem kleinen Schnitt den Eingang zum Gallengang/Pankreashauptgang zu vergrößern (Papillotomie).
In geübten Händen ist die ERCP sicher und komplikationslos. Selten kann es aufgrund der Untersuchung zu einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, Gallenwegsinfektionen oder einer Blutung kommen. Äußerst selten (bei weniger als 1% aller Patienten) kann eine notfallmäßige Operation erforderlich werden.












 erhält Young Investigator Grant 2023 der IAP und der APA Foundation für Forschung
erhält Young Investigator Grant 2023 der IAP und der APA Foundation für Forschung