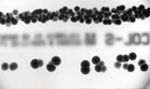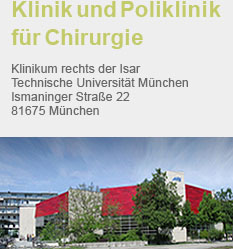
Bauchspeicheldrüsenkrebs
Was ist Krebs?
Krebs kann grundsätzlich in jedem Teil des menschlichen Körpers entstehen, wenn einzelne Zellen anfangen, sich mehr als normal zu vermehren, der Wachstumskontrolle des umgebenden Gewebes zu entweichen und dann in andere Gewebe oder Organe einwachsen. Krebs entsteht häufig auf Grund von angeborenen oder erworbenen Gendefekten. Die Gründe, warum diese Defekte auftreten, sind auch heute noch vielfach nicht bekannt.
Wird der Krebs nicht behandelt, so wächst oder wandert er in lebenswichtige Organe ein, deren normale Funktion er damit zerstört. Außerdem werden von Krebszellen manchmal schädliche Substanzen produziert, die zu Gewichts- und/oder Appetitverlust führen können.
Ziel der Behandlung der meisten Krebsarten im Bauchraum beim Menschen ist die vollständige chirurgische Entfernung des Tumors und seiner Ableger. Man spricht von „kurativer“ Chirurgie, wenn der Tumor vollständig entfernt werden kann und nach der Operation kein Tumorgewebe mehr im Körper verbleibt. Erfolgt die Chirurgie hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Symptomverringerung (z.B. Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität) spricht man von „palliativer“ Chirurgie.
Auch bei kurativer Chirurgie können Krebszellen im Körper verbleiben, weil einzelne Krebszellen schon in das umgebende Gewebe oder andere Organe eingewandert, bzw. metastasiert sind. Diese einzelnen Krebszellen sind zum Zeitpunkt der Operation nicht nachweisbar. In diesem Fall wird häufig eine zusätzliche Therapie, wie z.B. Chemotherapie oder Radiotherapie (Strahlentherapie) empfohlen, um noch möglicherweise vorhandene Krebszellen abzutöten. Diese Form der Therapie wird „adjuvante“ Therapie genannt.
Zusätzlich kann in bestimmten Fällen, in denen der Tumor nicht vollständig entfernt werden konnte, eine Zusatztherapie wie Chemotherapie oder Radiotherapie empfohlen werden, um das Tumorwachstum zu kontrollieren, bzw. um die Symptome, die durch den verbleibenden Tumor entstehen, zu reduzieren. Diese Form der Therapie wird „palliative“ Therapie genannt.
Durch die Fortschritte in der Chemo- und Radiotherapie können schwerwiegende Nebenwirkungen, wie sie früher durchaus üblich waren (wie z.B. Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall), vermieden oder deutlich reduziert werden. Um einen weiteren Fortschritt in der Therapie zu ermöglichen, werden an großen Krankenhäusern oft klinische Untersuchungen durchgeführt, um die beste Behandlung für den Patienten zu erarbeiten. Hierzu werden Patienten verschiedenen Behandlungsgruppen zugeordnet, um diese vergleichen zu können. Die optimale Versorgung des Patienten steht dabei jedoch immer im Vordergrund.
Was ist Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Die Ursachen des Bauchspeicheldrüsenkrebses sind zur Zeit nicht bekannt, jedoch ist bei einigen Patienten eine Verbindung mit dem Rauchen anzunehmen.
Am häufigsten entsteht der Bauchspeicheldrüsenkrebs im Kopf der Drüse (Abb. 8 + 9). Dies hat folgende Konsequenzen: Erstens verstopft das Krebswachstum den Gallengang, was dazu führt, dass sich die Galle bis in die Leber zurückstaut und nicht mehr oder nur vermindert ausgeschieden werden kann. Es kommt zur Gelbsucht, durch den in der Haut abgelagerten Gallefarbstoff, kombiniert mit einem dunklen Urin und einer hellen Stuhlfarbe. Bei Gelbsucht kann es auch zu verstärktem Hautjucken kommen, welches schnell abklingt, sobald die Blockade des Galleabflusses im Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt wurde. Zweitens kann der Tumor im Bauchspeicheldrüsenkopf den Bauchspeicheldrüsengang blockieren, was dazu führt, dass die Verdauungsenzyme, die die Bauchspeicheldrüse produziert, nicht mehr in den Darm gelangen. Dies führt zu Verdauungsstörungen, Gewichtsverlust und Durchfall.
Diese Symptome können behoben werden, indem man die Bauchspeicheldrüsenenzyme durch Tabletten/Kapseln ersetzt oder die Blockade im Bauchspeicheldrüsengang aufhebt. Eine Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus) kann erstes Symptom eines Bauchspeicheldrüsenkrebses sein und zeigt sich oft schon vor der Diagnose des Bauchspeicheldrüsenkrebses. Die Blutzuckerkrankheit kann jedoch auch nach der Diagnose oder nach der Operation auftreten.
Insbesondere sind Patienten über 60 Jahre betroffen, an Bauchspeicheldrüsenkrebs können aber auch jüngere Patienten erkranken.
Wie entsteht er?
Grundlagenforschung mit Hilfe von molekularbiologischen Methoden hat in den vergangenen Jahren zu einer wesentlichen Erweiterung unseres Wissens über die Entstehung des Bauchspeicheldrüsenkrebses beigetragen. So beobachtet man das vermehrte Vorhandensein von Faktoren, die das Wachstum der Krebszellen stimulieren (Wachstumsfaktoren), sowie Veränderungen (Mutationen) von bestimmten Erbsubstanzen (Genen), die normalerweise das Zellwachstum und den geregelten Zelltod (Apoptose) kontrollieren. Außerdem produzieren die Krebszellen Substanzen, die einen positiven Einfluss auf die Fähigkeit der Bauchspeicheldrüsenkrebszellen haben, in das umgebende gesunde Gewebe bzw. in andere Organe einzudringen und Ableger (Metastasen) zu bilden. Desweiteren bildet der Tumor Substanzen, welche die Bildung neuer Blutgefäße anregt. Diese braucht der Tumor, um weiter wachsen zu können. Die veränderte Funktion dieser Faktoren verschafft dem Bauchspeicheldrüsenkrebs einen Wachstumsvorteil gegenüber dem gesunden Gewebe und ist wahrscheinlich auch für die Resistenz des Tumors gegenüber Chemotherapie und Radiotherapie verantwortlich.
Weitere Untersuchungen sind beim Bauchspeicheldrüsenkrebs notwendig, um diejenigen Veränderungen zu charakterisieren, welche Ansatzpunkte für neue Therapieformen bilden könnten. Dadurch wird es hoffentlich gelingen eine verbesserte und wirkungsvollere Therapie des Bauchspeicheldrüsenkrebses zu entwickeln.
Was sind die Krankheitszeichen?
Unglücklicherweise sind die Symptome des Bauchspeicheldrüsenkrebses relativ uncharakteristisch. Am häufigsten beobachtet man eine Einschränkung des Allgemeinzustandes, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit. Die Patienten klagen auch häufig über Schmerzen im Oberbauch, welche eventuell in den Rücken ziehen und meist im Laufe der Erkrankung an Stärke zunehmen. Wie schon im vorangehenden Abschnitt erwähnt, kann es bei Tumoren im Bauchspeicheldrüsenkopf zu einer Störung des Gallenabflusses kommen. Dies führt zu einer Gelbsucht, die mit farblosem Stuhl, dunklem Urin und Hautjucken einhergehen kann. Ausserdem beobachtet man häufig eine neu aufgetretene Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus) bei Patienten, die an einem Bauchspeicheldrüsenkrebs leiden.
Was sind die Ursachen?
Die genauen Ursachen, weshalb Bauchspeicheldrüsenkrebs entsteht, sind nach wie vor unbekannt. Als einziger sicherer Risikofaktor für Bauchspeicheldrüsenkrebs ist bisher das Rauchen erkannt worden. Hinsichtlich bestimmter Ernährungsgewohnheiten, wie z.B. Kaffeekonsum oder fettigem Essen, konnte keine sichere Beziehung zum Bauchspeicheldrüsenkrebs nachgewiesen werden. Ob ein erhöhter Alkoholkonsum alleine zu einem höherem Risiko führt, an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken, wird zur Zeit noch widersprüchlich diskutiert. Eine vorbestehende chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, insbesondere die angeborene Form dieser Erkrankung, stellt ebenfalls einen Risikofaktor zur Entstehung des Bauchspeicheldrüsenkrebses dar.
Wie kann man Bauchspeicheldrüsenkrebs früh erkennen?
Es ist heutzutage leider häufig noch nicht möglich, den Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Stadium zu erkennen. Es gibt daher keine einfache Vorsorgeuntersuchung. An der besseren Früherkennung des Bauchspeicheldrüsenkrebses wird jedoch intensiv geforscht, und die Grundlagenforschung wird sicherlich neue und bessere Diagnoseverfahren in die klinische Praxis bringen.












 erhält Young Investigator Grant 2023 der IAP und der APA Foundation für Forschung
erhält Young Investigator Grant 2023 der IAP und der APA Foundation für Forschung